
Schreibstube: Sprachschatztauchen – wie man den Thesaurus bändigt
![]() In der Skoutz-Schreibstube geht es heute mal weniger um die richtige Technik, sondern um das Werkzeug selbst. Unsere Sprache. Die Worte, aus denen ein Text besteht, durch die eine Gechichte lebendig wird. So wie Sprache lebendig ist. Ein spannendes Thema, das für jeden Texter, sei es auf dem Messenger, in einem Blog, auf einer Webseite, in einem Buch, von Interesse ist – oder zumindest sein sollte.
In der Skoutz-Schreibstube geht es heute mal weniger um die richtige Technik, sondern um das Werkzeug selbst. Unsere Sprache. Die Worte, aus denen ein Text besteht, durch die eine Gechichte lebendig wird. So wie Sprache lebendig ist. Ein spannendes Thema, das für jeden Texter, sei es auf dem Messenger, in einem Blog, auf einer Webseite, in einem Buch, von Interesse ist – oder zumindest sein sollte.
Sprachschatztauchen …
Ich habe heute bei einem lieben Freund einen seiner Texte lesen dürfen, in die er sehr viel Herzblut gelegt hat. Interessant.
Weil gerade dadurch, dass ich zwar die Seele des Textes beim Lesen erfühlen konnte, aber zugleich das ungeübte Handwerk erkannte, mir die Bedeutung guter Sprache wieder bewusst wurde.
Als würde das Herz wie ein großer Komponist die schönste Sinfonie ersinnen und sie dann die Hand wie das ungeübte Dorfschulorchester interpretieren. Es klingt schrecklich schief, aber man erkennt doch noch die dem Stück eigentümliche Magie.
Wortmagie, Textmagier, Zeilenzauber …
Es beginnt schon mit den Worten selbst. Sprache ist lebendig. Deutsch ist scharf und nicht versehentlich die Sprache der Dichter und Denker, denn sie will durchdacht verwendet werden. Wortreich, wortgewandt und mit feinem Gespür für die Möglichkeiten, die sie durch die Positionierung einer Vokabel im grammatischen Gefüge eines Satzes bietet oder durch das wunderbare Kombinieren und Zusammensetzen. Ein echter Sprachschatz eben.
Purer Mischmasch?
Der normale Sprachschatz hat heute verfluchte Ähnlichkeit mit etwas, das man in einem Elsternest findet. Kunterbuntes Zeug, mehr oder minder wahllos aufgeschnappt und zusammengebastelt. Mir blutet manchmal das Herz, wenn ich sehe, wie lieb- und vor allem achtlos man heute mit unserer Muttersprache umgeht.
Ich bin kein Sprachpurist, ich kann gut mit englischen, griechischen, lateinischen, arabischen und vielleicht auch mal chinesischen Begriffen in meinem Sprachschatz leben. Ein gesunder Mix ist toll. Wir werden internationaler und warum sollten wir nicht von anderen Sprachen lernen? Es ist wie mit den Gewürzen oder exotischen Zutaten beim Essen. Mag ich auch. Aber es schmerzt, wenn ich mitverfolge, wie zunehmend andere Sprachen von Leuten, die sie oft noch nicht mal wirklich beherrschen, als schöner, moderner, besser eingestuft werden.
Nun, die mangelnde Beherrschung sollte kein Hinderungsgrund für diese Einschätzung sein, denn allzu oft, kann derjenige auch die eigene nicht. Oder jedenfalls nicht richtig. Unser Wortschatz verkürzt sich, die Grammatik versandet. Wenn man im Konjunktiv schreibt oder gar Futur II bemüht, gilt man als hochgestochen oder gar veraltet. Auch Lektoren drängen da auf immer einfachere Strukturen, von leseleicht, zu vereinfacht, einfach und schließlich leichter Sprache. Wollen wir das in der Belletristik?
Wie groß ist unser Sprachschatz?
Die Uni Leipzig hat mal nachgezählt und überprüft, welche Vokabeln denn die 10.000 heute häufigst gebrauchten Wörter sind (Wortschatz Leipzig). Klar, dass Artikel, Bindeworte und Pronomen da ganz vorn stehen. Dicht gefolgt von den Hilfsverben „sein“ und „haben“. Oder vielleicht auch „soll“ und „haben“, wenn wir schon von Sprachschatz reden?
Wie viele wunderschöne Worte tauchen dagegen gar nicht mehr in der Liste auf, dem Vergessen anheimgestellt, das es selbst gerade noch in die Liste geschafft hat (Platz 9.921).
Meine Ausgabe des „Wahrig“ erfasst seinem Klappentext zufolge ca. 260.000 Stichworte. Das ist ein guter Mittelwert zwischen aktivem und passivem Repertoire. Der passive Sprachschatz, also das, was man versteht, wenn man es hört („anheimstellen“ wird z.B. gerade noch verstanden, aber fast nirgends mehr verwendet), beträgt etwa 500.000 Worte. Eher mau schaut es mit dem aktiven Wortschatz aus. Wikipedia berichtet allzeit hilfreich, dass der Durchschnittsdeutsche sich mit etwa 70.000 Wörtern durchs Leben stammelt, wobei man mit deutlich weniger (2.000) bereits in der Lage ist, sich verständlich zu machen, ob da wildes Gestikulieren und Grimassen schneiden mitgezählt werden, weiß ich aber nicht.
Schatzsucher und Schatzwächter?
Schriftsteller sind Sprachprofis – oder sollten es zumindest sein. Sprachschatz-Sucher und -Wächter.
Das heißt, wenn man sich einer reduzierten Sprache bedient, so sollte dies bewusst geschehen und nicht etwa, weil einem die Worte fehlen. Je größer der aktive Wortschatz des Autors ist, desto plastischer wird er beschreiben können, was ihm am Herzen liegt. Desto präziser wird er die Bilder, die er beim Erzählen vor seinem inneren Auge beschwört, auch seinen Lesern übermitteln können. Das liegt daran, dass letztlich jedes Wort eben doch seine ganz eigene Bedeutung hat.
Das Synonym ist ein Trugschluss
Es ist etwas anderes, ob der Protagonist „Nein“ sagt, spricht, knurrt, ruft, brüllt, zischt, seufzt, flüstert, haucht oder lispelt. All diese Verben beschreiben zwar immer eine Äußerung, färben sie aber anders ein und geben ihr dadurch eine Betonung, mit der ein gewitzter, geschickter oder auch nur geübter Autor dem Leser einen wichtigen Hinweis auf die Szene gibt, in der das „Nein“ fällt. Das setzt aber eine geübte Hand im Umgang mit so feingliedrigem Werkzeug voraus, denn wenn man ohne rechtes Gespür für das passende, wenn schon nicht richtige Wort lostippt, so wird die Suche nach Alternativen zum immer gleichen „sagen“ am Ende schnell zur Irrfahrt.
Wenn ein Prota etwa einen seitenlangen Monolog „seufzt“, frägt man sich spätestens im Selbstversuch, wo zum Henker der das Lungenvolumen dafür hernimmt. Davon, dass es sehr albern klingen würde, mal ganz abgesehen.
Ich rege mich zum Beispiel auch oft über die einfallslosen oder auch einfältigen, vielleicht auch nur schlampigen Übersetzer auf, bei denen ständig „gewispert“ wird – bevorzugt von Protagonistinnen mit bebender Brust. Wispern ist ein Wort, das natürlich im Deutschen vorkommt. Doch eher selten und in einem anderen Zusammenhang als im Englischen das artverwandte „to whisper“. Tja…
Brillante Sprache mit Vokabeln, die funkeln
Leser möchten in die Geschichte abtauchen. Das gelingt umso einfacher, je kräftiger die Worte sind, mit denen man ihre Fantasie kitzelt.
Es ist ein Unterschied, ob eine Burg nun groß ist oder eben etwas anderes.
So sind die großen Burgen meiner Welt entweder
- wuchtig wie Eisenberg,
- verwinkelt wie Athon,
- weitläufig wie Kiblis,
- erdrückend wie Walhal,
- geräumig wie Peritai und
- hochaufragend wie Edehlis.
Das alles sind Worte, die zwar nicht zwingend etwas zur Größe sagen, gleichwohl können sie oftmals viel stärkere Bilder vor dem geistigen Auge des Lesers erzeugen. Und da die Burgen selbst das Stadtbild beherrschen, unterstellt man automatisch eine gewisse Größe. Hoffe ich.
Ein lachhaftes Beispiel:
Ganz schlimm ist es auch mit dem Lachen.
Lachen ist so schön, so menschlich und so unglaublich charakterisierend. Ich staune immer wieder, wie viel ein Mensch von sich durch sein Lachen verrät. Ich weiß nicht, ob es wirklich typisch und vor allem exklusiv menschlich ist, aber es ist jedenfalls höchst individuell. Und situativ variantenreich obendrein. Doch wird meist eben nur gelacht. Und das, obwohl die deutsche Sprache da hilfreich wie stets den Gebrüdern Grimm zufolge eine schier unüberschaubare Zahl von „Lach“-Synonymen zur Verfügung gestellt hat, damit jeder Protagonist die ihm gebührende Heiterkeits-, Freuden-, Glücks- oder Missfallensbekundung dem Leser unaufdringlich und mit einem Wort präsentieren kann:
Lächeln, schmunzeln, feixen, glucksen, jauchzen, grinsen, grienen, kichern, keckern, wiehern…
Dabei gäbe es darüber hinaus auch noch die wunderbare aber vielleicht schon fortgeschrittene Möglichkeit, das Bedürfnis zu lachen, auch szenisch auszudrücken, durch Worte wie begeistert, erheitert, amüsiert, spöttisch, neckend, zwinkernd, veralbernd mit denen man das, was der Protagonist sagt, schmücken kann. Idealiter, ohne dann in sperrig zu lesenden Adjektivismus zu verfallen. Aber wenn es leicht wär, könnt es jeder.
Getreu des alten Grundsatzes „show, don’t tell“ könnte man natürlich auch hüpfen, klatschen, auf dem Stuhl rutschen, aufspringen, sich umdrehen, die Augen aufreißen oder stürmisch umarmen, was immer einen beglückt.
Die Sprache des Protagonisten
Doch wie fühlt sich der Protagonist dabei? Und wie drückt er das aus? Speziell, wenn es seine Perspektive ist, derer sich der Autor bedient.
Ein Arzt wird einen Mann anders beschreiben als ein Händler und der anders als ein Kind.
Die Redewendungen, die einen Fischer beschreiben, sind andere als die, die man bei einem Jäger oder einem Händler erwartet. Ein noch so guter Spruch zur falschen Zeit wird allenfalls unfreiwillig komisch sein.
Ein Gelehrter drückt sich anders aus als ein Schuster und der wieder anders als ein Fürst – jedenfalls meistens.
Falls es dem Autor gelingt, die Sprache seiner Protagonisten authentisch zu machen, haben die es leichter, in den Lesern Freunde zu finden.
Wenn man mich z.B. so hört, wie ich über die Unzulänglichkeiten in den Texten meiner Kollegen lästere, würde ein Jäger wie Barrad sagen, dass das sei, als würde der Rabe die Krähe schwarz schimpfen. Wenn dagegen ein Mann von der Küste wie Kurd oder Kaska dasselbe sagen wollten, wäre es bei ihnen die Sardine, die den Hering schuppig heißt.
Das alles setzt einen sehr bewussten Umgang mit Sprache voraus. Würden sie sich nicht in einer High Fantasy-Welt, sondern im modernen London bewegen, klänge beides seltsam und ich müsste wieder mit anderen Sprachbildern arbeiten.
Zu Recht, denn das verlangt man schließlich von einem Arzt mit dem Skalpell ebenso wie vom Mechaniker mit dem Schraubschlüssel.
Das ist wichtig, wenn ein Protagonist nur die Sprache des Autors hat, um lebendig zu werden, um sich plastisch und echt anzufühlen. Um geliebt, gehasst, gewollt und – aus Sicht des Autors jedenfalls – auch gekauft zu werden.
Sprache muss authentisch sein
Peinlich wird es, wenn man als Sprachschatz-Dieb entlarvt wird. Wer sich plötzlich, nur um nicht einfach zu klingen, möglichst vieler Vokabeln bemüht, die er nicht verinnerlicht hat, wird eher peinlich anrührend als überzeugend wirken. Es muss passen. So wie man einem Menschen auch ansieht, ob er einmal oder öfter Anzug, Weste und Krawatte trägt. Oder High-Heels für die Damen. Oh ja.
Sprache ist reich an Bildern, vieles gibt wortwörtlich keinen Sinn und einer meiner Protagonisten, ein Lehrling namens Fink, kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Er neigt dazu, all das, was man ihm den ganzen Tag so erzählt, wörtlich zu nehmen. Eine interessante Erfahrung, die auch mich beim Schreiben zu einem völlig neuen Sprachgefühl zwingt. Aussagen wie „kein Wort“ oder auch „kein Sterbenswörtchen sagen“ bekommen vor Finks Ohren eine ebenso andere Bedeutung wie das schnell dahin gesagte „mundtot machen“.
Ich überlege oft, wie ich eine Szene besonders gut beschreiben kann, und freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich denke, dass es mir gelungen ist. Wenn ich dann positives Feedback bekomme, ist mein Tag gerettet.
Also, ich freue mich natürlich über jedes Feedback. Über positives offen gestanden mehr, als über Kritik. Und über das, das ich mir auch richtig erarbeitet habe eben ganz besonders.
„Schwer zu glauben, dass es immer noch früh am Morgen war. Ihr kam es in diesem Augenblick vor, als hätte sie nicht nur den Tag, sondern noch ein ganzes Leben vor sich.“
Nutzt ihn, um zu schreiben, taucht nach Sprachschätzen, hebt sie und lasst mit ihnen die Augen eurer Leser glänzen.
Weiterführende Links:
Hilfreich für alle, die sich kritisch mit ihrem Muttersprachschatz auseinandersetzen wollen kann ich nur das Goethe-Wörterbuch und das bekanntere Grimm’sche Wörterbuch empfehlen.
Und wem das zu trocken ist, der findet in der Datenbank des Gutenbergprojekts, eine große Auswahl an gemeinfreien Romanen, Novellen, Erzählungen, Gedichten und anderen Texten.
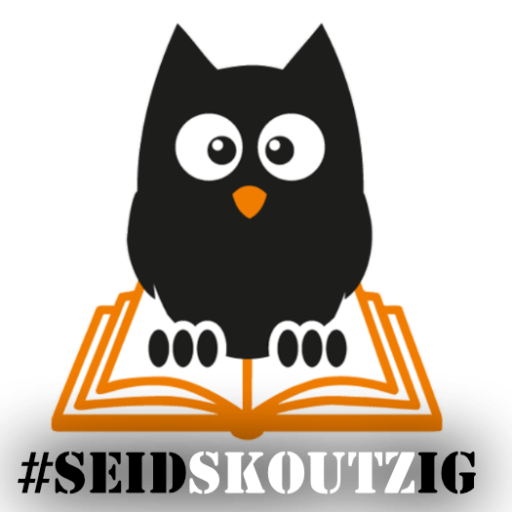




One Comment
Pingback: