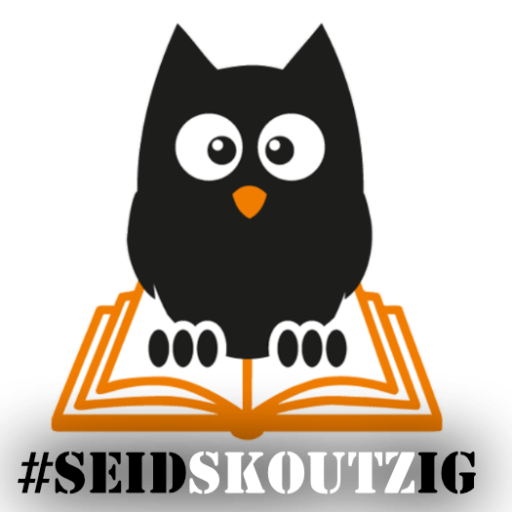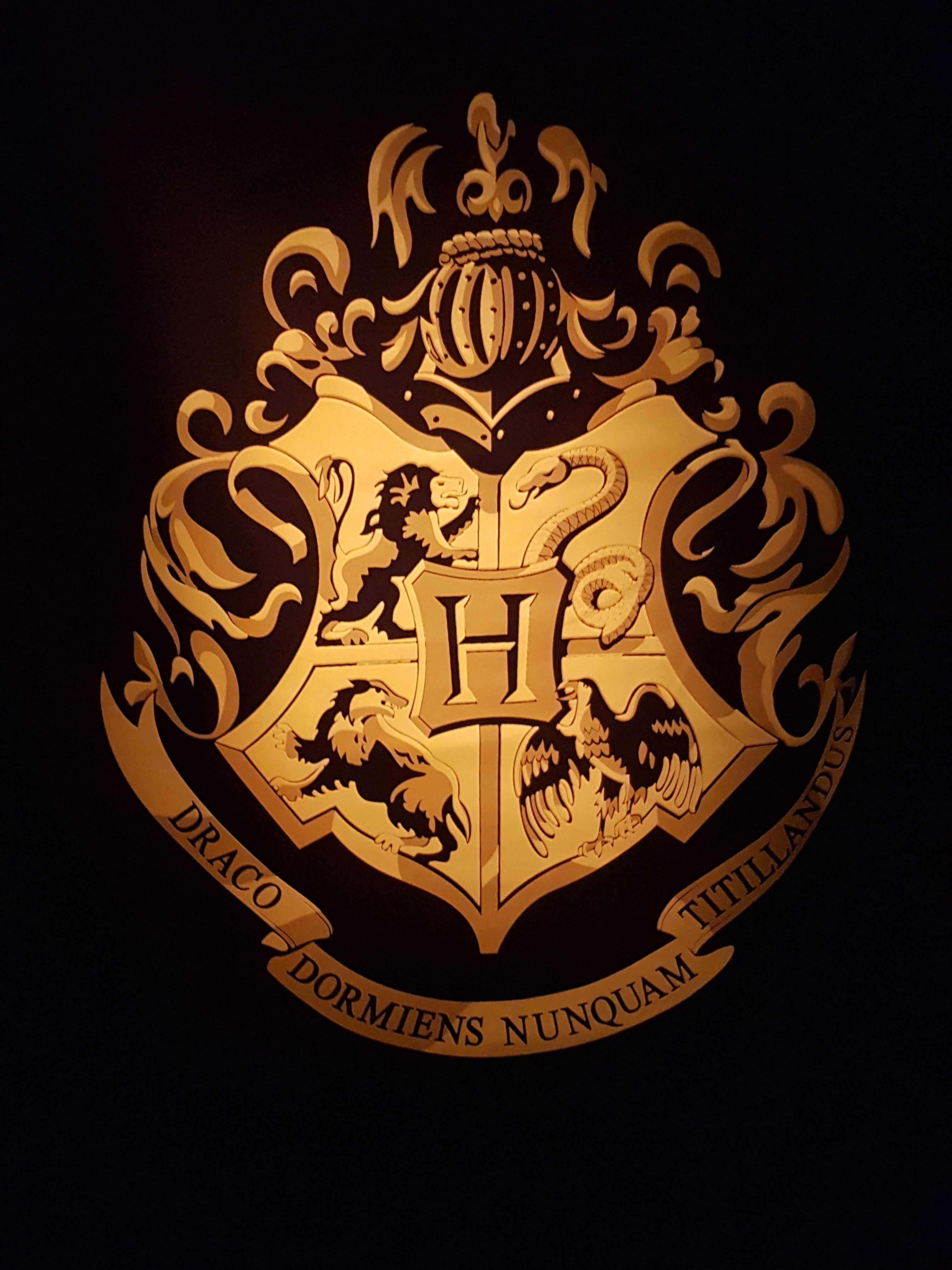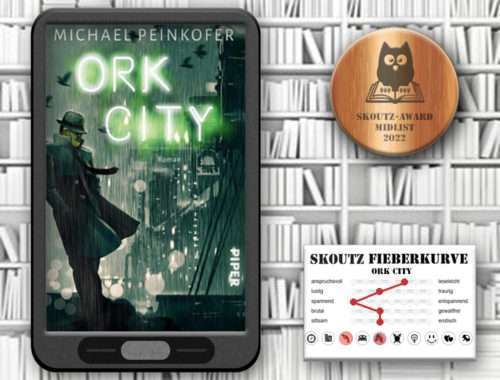Wir unterhalten uns hier oft darüber, wie man etwas schreiben soll. Diese Regeln sind wichtig. Aber lasst uns einmal darüber sprechen,
was man schreiben soll. Lasst uns über Unworte sprechen und wer eigentlich das Etikett „Unwort“ vergeben darf. Sprechen wir von Worten, die ihren Bedeutungsgehalt verändert haben und dadurch in die Gosse abgerutscht sind, aber auch über nagelneue Worte, die uns kritisch aufhorchen lassen sollten.
Es geht um Sprachpsychologie und Rede- und Meinungsfreiheit, zu denen eben auch die Verantwortung zur kritischen Auseinandersetzung gehören. Und um die sehr wichtige Frage, wer eigentlich die Deutungshoheit über unsere Wortwahl haben darf.
Sprachhygiene

Sprache sollte bewusst eingesetzt werden und auch die Wortwahl unterliegt bestimmten Regeln. Es gibt Gelegenheiten für den kunstvollen Austausch geschliffener Bonmots und Fälle, wo man die verbalen Gummistiefel anzieht und höchst fäkal losflucht. Sprachhygiene ist wichtig, aber wie mit der Hygiene im Haushalt sollte man es auch nicht übertreiben. Sie produziert sonst schnell unter der Oberfläche vermeintlich effektvoller Verbote multiresistente Keime aus Trotz und Hilflosigkeit.
Sprachhygiene und Verbote
Natürlich gibt es Worte, die man mit Rücksicht auf ihre Herkunft und die Bedeutung, die ihnen beigemessen wird, nur mit Bedacht und zurückhaltend verwenden sollte. Falsch wäre aber, sie gar nicht mehr zu verwenden, denn das konterkariert die Intention.
Worte generell zu verbieten, ja sogar rückwirkend auszumerzen, scheint mir beim besten Willen nicht Freiheiten zu schaffen und die Gesellschaft oder gar Welt zu verbessern. Es wirkt eher so, als würden die Käfigstäbe verschoben. Ich möchte über Themen und nicht über Konsonanten streiten.
Verantwortungsbewusste Sprache
Wenn man also zum Beispiel das oft bemühte Wort „Neger“ verwenden will, muss man für sich und ggf. kritisch fragende Mitbürger begründen können, warum man das tut. Man könnte nun sagen, weil es von negro = schwarz kommt und daher treffend beschreibt, was gemeint ist, und das – anders als Nigger – auch nicht herabwürdigend sei.
Dem kann (und soll) man entgegenhalten, dass man bei der Kommunikation auf den Empfängerhorizont abstellen muss. Während man selbst hoffentlich weiß, was man ausdrücken will, ist das dem Gegenüber frühestens dann klar, wenn ihn die Botschaft per Schrift oder Ton erreicht. Neger wird nun einmal heute von der Mehrheit als abwertend verstanden und wenn es nicht so gemeint ist, sollte man ein anderes Wort bemühen. Soweit so einfach. Wenn man nun nicht mehr schwarz nennen darf, was schwarz ist, weil auch das … tja, dann macht sich bei der Kommunikation eine gewisse Gereiztheit breit. Wer dann von maximal pigmentierten Mitbürgern spricht, versucht mit dieser wenig praktikablen Überspitzung eher sein Missfallen gegen den Maulkorb als seine Rücksichtnahme auszudrücken. Sprache will auch einfach sein, praktikabel.
Sprachhygiene im Kontext
Sprache ist eine Zusammensetzung einzelner Worte. Sie alle ändern im jeweiligen Kontext ihre Bedeutung, selbst wenn man Mimik und Gestik des Sprechers oder die Tonlage und Betonung außeracht lässt.
- Ich geh laden (Sven, 50, LKW-Fahrer)
oder
- Ich geh Laden (Mustafa, 23, in der Fußgängerzone)
oder
- Ich geh laden (Claire, 15, deren Handy-Akku leer ist)
oder
- Ich geh laden (Rosie, 46, obdachlose Spiegeltrinkerin)
Das ist bei kritischen Worten nicht anders. Und so sollte man auch Neger und andere böse Worte verwenden dürfen, wenn es opportun ist. Im historischen Kontext etwa. Es ist grotesk, in einer Geschichte aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs auf dieses Wort zu verzichten. Ebensowie eine Mittelalterhistorie nur schwer ohne das heute verpönte Weib auskäme. Ebenso verhält es sich, wenn man gerade Widerspruch oder Kritik provozieren will. Wenn sich ein Bösewicht im Buch nicht mehr wie ein Bösewicht ausdrücken darf, habe ich als Autor ein Problem. Wenn ein Arschloch nicht durch seine Taten und Worte belegen darf, was es ist, muss ich ihn und seine Gesinnung beschreiben. Echt jetzt? Das macht mein Buch nicht besser. Show, don’t tell – aber wie soll das politisch korrekt gehen?
Tina Uebel hat sich in einem wirklich absolut lesenswerten Artikel über diese Problematik sehr ausführlich in der Zeit Gedanken gemacht.
Sprachhygiene und die Pflicht zur Selbstkritik
Sprache ist mehr als Buchstabenkombinationen im grammatikalischen Konzept. Natürlich kann es deshalb passieren, dass man sich mal im Ton vergreift oder eben in der Wortwahl. Das ist ärgerlich in der Situation, aber gut für das Gesamtkonzept, denn es erlaubt die Diskussion und das Verständnis.
Ein schönes Beispiel ist ein Patzer von Sascha Lobo, der arglos und weil er es nicht besser wusste, ein Wort verwendet hat, das von der so bezeichneten Gruppe durchaus nachvollziehbar als diskriminierend empfunden wird. Er hat sich dafür in einem Beitrag öffentlich entschuldigt und so vielen (mir zum Beispiel) erst gezeigt, dass „She-Male“ für Trans-Frauen kein treffender, sondern ein unglücklicher Begriff ist. Sprache ist Wandel und wenig trägt mehr zum gegenseitigen Verständnis bei, als sich über solche Begrifflichkeiten zu unterhalten. Schön vor allem, weil der Artikel aufklärt ohne in Apellen zu enden.
Trotzdem kann man Uebel und Lobo schwer vergleichen, denn einmal geht es darum, abwertend hinterlegte Begriffe weiterhin gezielt zu verwenden – sei es im historischen Kontext, in der Satire oder in der kritischen Auseinandersetzung. Lobo hingegen geht es um die fahrlässige Verwendung verletzender Begriffe, und die damit gerade die gewünschte Aussage konterkarieren.
Salih Jamal sagt dazu in einer Diskussion sehr richtig, dass die Pole wichtig sind, „die alles im Gleichgewicht halten“. Wie beim Laufen auch, ist auch Sprachfortschritt ein ständiges Ringen um die Balance. Würden wir alle unangenehm belegten Begriffe, alle Neger, Weiber, Nazis, Kaffer, Eskimos und Spaghettis aus unserer Sprache verbannen, verzichten wir auch auf ihre Signalwirkung. Wer die Vergangenheit verleugnet, muss sie am Ende wiederholen. Wenn wir uns nicht der rassistischen Historie stellen, erliegen wir schnell der trügerischen Vorstellung, Gleichberechtigung sei selbstverständlich. So, wie wir gedacht haben, Meinungsfreiheit und Demokratie seien selbstverständlich. Eine Annahme, die aktuell täglich in der Tagesschau widerlegt wird.
Übergriffigkeit und Deutungshoheit
Es ist unvermeidlich, dass Begriffe sich in ihrem Bedeutungsgehalt wandeln. Das sieht man schön in kurzer Zeit an „geil“, das von einem agrartechnischen Begriff („Geilwuchs“) zu einem verpönten Jugendwort zu einem salonfähigen Synonym für „super“ wurde. Oder, in längerem Abstand, die „Magd“, die von einem adeligen Mädchen zur Arbeitshilfe degradiert wurde und im Nachgang einen beleidigenden Beigeschmack erwarb. Das ist ein natürlicher und basisdemokratisch, aus der Masse der Sprechenden heraus, zu gestaltender Prozess.
Sprache und Wahrheit
Sprache schafft Wahrheiten, hört man oft und speziell dann, wenn es um den leidigen Streit um die politisch korrekte Gender-Endung geht. Ich persönlich bin ein erklärter Gegner von Binnen-I und Sternchen oder Unterstrichen, um meine vorgebliche Geschlechtergleichberechtigung zu demonstrieren. Dadurch wird meines Erachtens der Fokus gerade auf die Unterscheidung gelenkt, doch darum geht es gerade nicht. Ich erlebe täglich, dass Sprache weniger Wahrheiten schafft, als sie ausdrückt – und ggf. auch verrät: Das Wort folgt dem Gedanken und nicht umgekehrt.
Sprachtradition
Misstrauisch werde ich deshalb nicht bei alten Worten wie den männlichen Endungen, die heute nicht anders als die geile Magd eine Bedeutungsänderung erfahren haben und eben auch Frauen meinen. Meine Alarmglocken beginnen zu schrillen, wenn ich neuen Worten begegne, die Begriffe ersetzen, die bisher völlig ausreichend zur Beschreibung waren.
Wortneuschöpfungen
Was sagt das über den Verwender aus, wenn er einen neuen, einen anderen Begriff verwendet? Warum sagt man z.B. Asyltourismus statt Flucht? Nichts verbindet Asylbewerber mit Touristen! Die Menschen, die eine lebensgefährliche Überfahrt über das Mittelmeer auf sich nehmen, sind mit einer großen Hoffnung unterwegs, fort von Krieg, Gewalt und Armut.
Doch auch der Begriff Asylbewerber hat eine erstaunliche Wandlung erfahren. Ursprünglich einmal hieß es völlig diskriminierungsfrei „Asylant„. Bis wem auffiel, dass die Endung -ant überwiegend diskriminierend sei. Das mag Demonstranten und Praktikanten erstaunen, aber gut. So wurde es der Asylbewerber, bis dann Asyl, obwohl ein juristisch definierter Begriff (Asylverfahrensgesetz), dann zum Flüchtling wurde, den man politisch feinfühlig besser durch Geflüchtete (weil genderkorrekt) oder noch besser Schutzsuchende ersetzen soll. Nun ja.
Schutzsuchend sind auch misshandelte Menschen in unserem Land, Obdachlose und viele mehr. Politisch rücksichtsvoll werden hier Unterschiede verwischt, die tatsächlich beachtenswert sind, weil sie zu einem jeweils völlig unterschiedlichen Handlungsbedarf führen. Ich möchte also ungern Oberbegriffe für Untereinheiten verwenden.
Hier muss jeder aufpassen, dass ihm nicht Bedeutungsgehalte durch Sprachkorrekturen untergeschoben werden, die man so weder ausdrücken noch hören will.
Sprache ist Identität
Was ich anstrengend und auch gefährlich finde, ist diese Übergriffigkeit mit der gewisse Kreise die Deutungshoheit unserer Sprache und ihrer Vokabeln für sich beanspruchen.
Einerseits, weil diese Haltung erst wahre Überheblichkeit (Rassismus, Diskriminierung) offenbart, die in Diskussionen so weit geht, dass den Betroffenen, die einwenden, sich im Kontext gar nicht diskriminiert zu fühlen, Dummheit unterstellt wird. Tatsächlich entspringt oft das identifizierte Schutzbedürfnis den eigenen Vorurteilen.
Ein Beispiel hierzu:
München, US-amerikanischer Konzern, Team-Meeting.
„Wir richten uns direkt an Sie als Asian-American …“
Meine Freundin widerspricht. „Ich bin Thai.“
„Ja das wissen wir, aber wir wollten Sie nicht diskriminieren.“
Meine Freundin: „Danke. Jetzt bin ich diskriminiert.“
Sprachhygiene und Vertrauen
Sprache setzt, wenn sie nicht so klingen soll wie bei Juristen (wovon ich aus praktischen und ästhetischen Gründendringend abrate), Vertrauen voraus. Wer seinem Gegenüber eine grundsätzlich positive Haltung unterstellt, hat es bei Verständigung unendlich viel leichter. Es funktioniert auch reibungsfreier, als wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legt, um dem Gegenüber eine mögliche Charakter- oder Gesinnungsschwäche nachzuweisen. Eine gewisse Hornhaut schadet also auch dem Hörenden nicht. Speziell, wenn man noch nicht einmal selbst betroffen ist und so vermeintlich bedürftigen Minderheiten die eigene Weltsicht aufdrängen will – höchst rücksichtsvoll natürlich.
Kommunikation wirft die Frage auf, wieviel Verantwortung für die eigenen Gefühle man der Gemeinschaft aufbürden kann. Ist die Aufforderung, nicht so empfindlich zu sein, wirklich immer die Rechtfertigung für Rücksichtslosigkeit? Ist es nicht oft die unvermeidliche Konsequenz des Miteinanders, sich auch einmal zurückzunehmen, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Wir betreten die Gefilde des modernen Narzissmus, wo Meinungsfreiheit mit „Jeder hat ein Recht auf meine Meinung“ übersetzt wird. Es berührt unsere Kritikfähigkeit und Kritikbereitschaft.
Zwangsbeglückung
Sprache als Ventil ist wichtg. Es hat eine befreiende Wirkung, Unangenehmes auszusprechen, zu fluchen oder auch mal zu schreien. Damit werden Emotionen abgebaut, die sonst nicht verschwinden, sondern sich häufig aufbauen, bis sie andernorts deutlich heftiger ausbrechen.
Politisch unkorrekte Witze sind zB ein wunderbares Mittel, Ängste wegzulachen und zu verarbeiten. Und dann, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, verschwinden die Witze erstaunlicherweise auch wieder. Ich weiß nicht, ob es gut ist, das kategorisch zu verbieten.
Sonst führt das schnell zur gegenteiligen Wirkung. Weil dieses grassierende Vokabelverbot eine spürbare Gereiztheit gegenüber den Schutzzielen provoziert. Die Suche nach aktuell geduldeten Vokabeln ist Stress, gerade für die, die nicht täglich solche Themen studieren. Den verbindet man, psychologisch nachvollziehbar, mit jenen, die man gerade bezeichnen wollte. Die negativen Gefühle werden also mit diesem Bild gemarkert und damit künftig vermieden. So wird das Gegenteil des Gewollten erreicht, aber die Sprachhygieniker können immer eifriger wettern.
Fazit
Also geht mit Sprache wieder unverkrampft um. Sprecht, wie ihr verstanden werden wollt und seid offen für das, was zurückkommt. Mit einem „So habe ich es nicht gemeint“, lässt sich das meiste geradebiegen. So aber können wir gemeinsam entscheiden, ob der Sprecher oder der Hörer im konkreten Fall die Korrektur vornehmen soll.